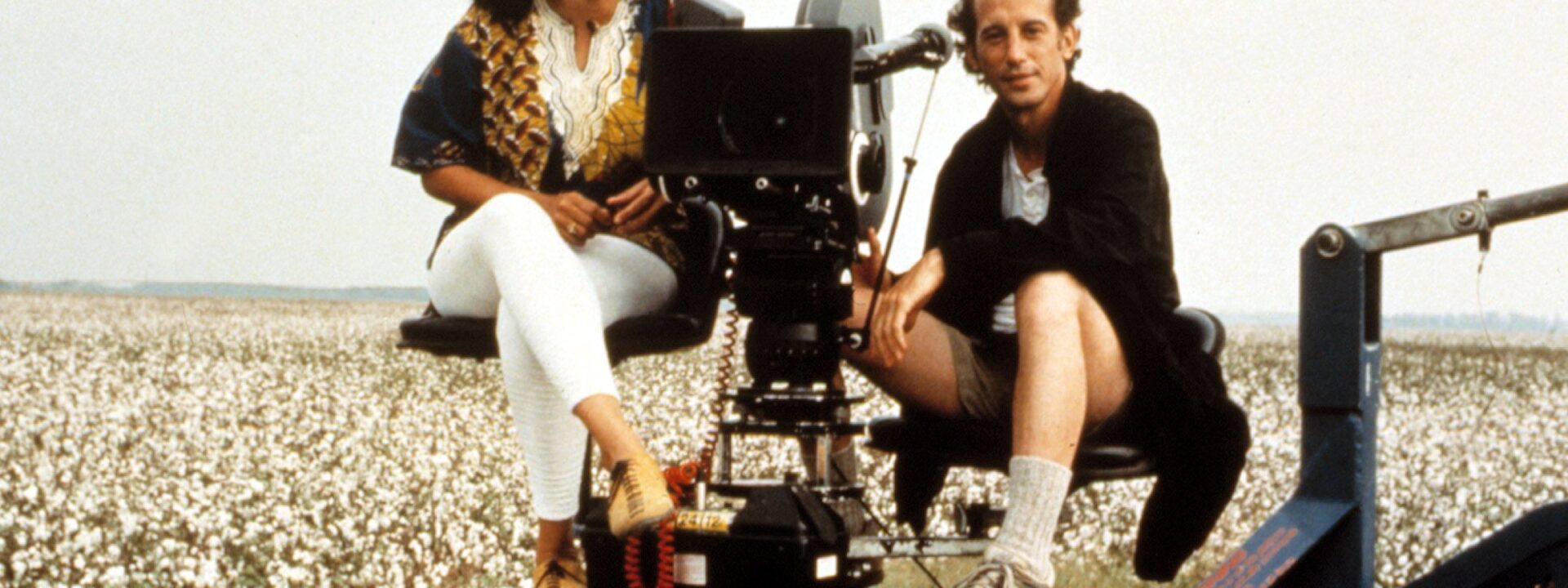Was bedeutet es, Indien der Welt zu präsentieren – nicht als klischeehafte Postkartenidylle, sondern in all seiner Tiefe und Widersprüchlichkeit? Seit mehr als dreißig Jahren tut Mira Nair genau das. Mit Filmen wie Monsoon Wedding (2001) brachte sie das pulsierende Chaos Delhis auf internationale Leinwände, und in The Namesake (2006) porträtierte sie einfühlsam den Schmerz der Ferne von der Heimat. Nun erkundet Bijoy Shetty ähnliche Themen durch ein anderes Medium. Mit 27 Jahren treiben seine Musikvideos für Künstler wie Hanumankind, Martin Garrix und Badshah den indischen Hip-Hop über reine Imitation hinaus, verankern ihn in lokalen Traditionen – von Dahi-Handi-Pyramiden und furchtlosen Motorradfahrern bis zu alten Kampfkünsten – und nutzen dabei einen visuellen Stil, der weltweit Anklang findet.
Als Nair und Shetty sich für Vogue über Zoom trafen, tauschten sie sich über ihre Arbeiten aus und sprachen über die Balance zwischen Authentizität und internationaler Zugänglichkeit. Vor allem aber ging es darum, der Versuchung zu widerstehen, Identitäten auf vermarktbare Klischees zu reduzieren. Für beide liegt die Herausforderung – und die Erfüllung – darin, Indien in seiner ganzen schön chaotischen Komplexität einzufangen.
Vogue: Mira, Sie bezeichnen sich als indische Filmemacherin, die sich überall auf der Welt zu Hause fühlt. Ihre Filme haben den Blick auf Indien und seine Diaspora verändert. Bijoy, Ihre Musikvideos, besonders die jüngeren mit Hanumankind, sind tief in der indischen Kultur verwurzelt. Wie wichtig ist Repräsentation für Ihren kreativen Prozess?
Mira Nair: Ich sehe mich nicht als Botschafterin, die die Herrlichkeit meines Landes preist. Ich mache keine Filme wie Benetton-Werbung. Mein Ziel ist es, die Facetten des Lebens um mich herum zu erkunden und das Menschliche zu finden, das jeden Ort einzigartig macht – Geschichten so ehrlich zu erzählen, dass sie universell werden. Wir sind nicht voneinander getrennt; wir teilen alle dieselbe menschliche Erfahrung. Als indische Filmemacherin in New York und später in Ostafrika fiel ich oft auf, wurde mit Erklärungsdruck konfrontiert. Doch ich war schon immer eigensinnig – ich rechtfertige nicht, wer ich bin, oder gebe Lektionen über mein Bindi. Und ich lasse nicht zu, dass Menschen, die nie in unseren Schuhen steckten, unsere Kultur verzerren.
Bijoy Shetty: Die Kolonialzeit hat uns geprägt und uns glauben lassen, westliche Kultur sei überlegen. Ehrlich gesagt habe ich sogar von diesem Vorurteil profitiert. Bei „Big Dawgs“ kam viel Aufmerksamkeit von der Überraschung, dass ein Inder so rappen kann. Nicht die Produktionsqualität, sondern der Schock über einen indischen Rapper machte das Video viral. Doch wenn die Überraschung verfliegt – hat die Arbeit dann eine starke Identität, die fesselt? Darauf kommt es an.
Vogue: Mira, Sie sagen, die Straße ist Ihre größte Inspiration, ob als Quelle Ihrer Geschichten oder bei der Besetzung mit Laien. Bijoy, Hip-Hop entstand auf den Straßen der Bronx. Was bedeutet die Straße als Charakter für Sie, und wie inspiriert sie Ihre Arbeit?
Mira Nair: Meine früheste Inspiration kam von der Straße – in Bhubaneswar, wo ich an Tempeln vorbeifuhr, Käfer nach dem Monsun beobachtete oder Odissi-Proben im Freien sah. Diese Alltagsszenen zeigten mir das Magische im Gewöhnlichen. Bei den Dreharbeiten zu India Cabaret (1985) lebte ich monatelang mit Tänzerinnen und wurde manchmal für eine gehalten. Diese Nähe lehrte mich, wie reich und komplex normale Leben sind. Ich sah Dinge, die in Fiktion als unglaubwürdig abgetan würden. Die Straße war meine unerschöpfliche Schule – sie lehrte mich Demut und Offenheit.
Bijoy Shetty: Fast alles, was ich erschaffe, kommt aus meinen Erfahrungen. In Maharashtra sah ich bei Dahi-Handi-Feiern oft Menschen stürzen. Diese Geschwindigkeit wollte ich einfangen – so entstand die Idee zum Video für „Weightless“ von Martin Garrix und Arijit Singh. Bei „Big Dawgs“ war es ähnlich: Als Kind ging ich mit meiner Familie oft ins Zirkus, und als ich den Song hörte, erinnerte mich ein Sample an ein Motorrad – da dachte ich an den „Well of Death“. Inspiration kommt für mich immer aus Erlebtem, Recherche und dem Instinkt, mein Leben filmisch umzusetzen.
Wie überwinden Sie kreative Rückschläge, wenn eine Aufnahme misslingt oder ein Film nicht den Erwartungen entspricht?
MN: Ich finde Trost in meinem Garten, denn die Bäume stellen keine Fragen. Der Rhythmus der Natur ist ein großartiger Lehrer – es gibt Zeiten zum Ruhen und zum Blühen. Was letzte Woche schön war, kann heute vergehen, also lernt man die Demut der Zeit. Yoga hilft mir sehr, und meine Familie auch. Aber die tiefe Einsamkeit, wenn eine Idee sich ganz anders entwickelt, bleibt.
BS: Es beschäftigt mich schon, aber es ist auch eine Art Superkraft geworden. Jeder Fehler treibt mich an, es beim nächsten Mal besser zu machen. Aus Angst vor Wiederholung passiert derselbe Fehler nicht nochmal. Wenn ich daraus gelernt habe, lege ich es beiseite und mache weiter.
Welchen Rat hätten Sie sich am Anfang Ihrer Karriere gewünscht?
MN: Nehmen Sie kein Nein hin. Man braucht das Herz eines Dichters und das Dickfell eines Elefanten. Es ist hart, weil man widerstandsfähig sein muss, ohne die Sensibilität zu verlieren, die eine gute Filmemacherin ausmacht.
BS: Es gibt keine Regeln. Man kann drehen, was man will. Lassen Sie sich nicht durch das begrenzen, was andere Ihnen beigebracht haben. Seien Sie einfach bereit, etwas Unbehagen auszuhalten, und finden Sie es unterwegs heraus.
Mira, Ihre Filme behandeln stets Identität und Zugehörigkeit. Ihr Sohn Zohran Mamdani adressiert ähnliche Themen nun in der Politik, als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von New York. Sehen Sie sein Engagement als Fortsetzung dieses Impulses in einem anderen Medium?
MN: Ich habe das Gefühl, Zohran führt uns in eine neue Morgendämmerung. Sein Mut und seine Klarheit beeindrucken mich, aber besonders berührt mich, wie er unerschrocken mehrere Welten in sich vereint und sie voll auslebt. Ich liebe, dass er uns allen Hoffnung gibt. Er hat eine visionäre Sicht auf die Welt, und es geht nicht um Macht – sondern um Gleichheit, Gerechtigkeit und echten Respekt für die arbeitende Bevölkerung.
BS: Sie müssen sehr stolz sein.
MN: Das bin ich, ja. Meine Mutter sagte 1988 auf den Filmfestspielen von Cannes, wo Salaam Bombay! gezeigt wurde: „Ich bin die Produzentin der Regisseurin.“ Heute sage ich: „Ich bin die Produzentin des Kandidaten.“
Diese Geschichte erscheint in der November-Dezember-Ausgabe 2025 von Vogue India, die jetzt erhältlich ist. Hier abonnieren.
Häufig gestellte Fragen
Natürlich, hier ist eine Liste von FAQs zu Mira Nairs und Bijoy Shettys Arbeit an einem neuen Indienbild.
Allgemeine Einsteigerfragen
1. Wer sind Mira Nair und Bijoy Shetty?
Mira Nair ist eine renommierte indisch-amerikanische Filmregisseurin, bekannt für Filme wie "Monsoon Wedding" und "Salaam Bombay!". Bijoy Shetty ist ein bekannter Filmproduzent und Gründer der Produktionsfirma Ek Katha. Beide sind kreative Partner, die sich authentischen indischen Geschichten widmen.
2. Was bedeutet es, das globale Bild Indiens zu verändern?
Es geht darum, über Klischees hinauszugehen und der Welt die wahre, vielfältige und komplexe Realität des modernen und traditionellen indischen Lebens durch authentisches Geschichtenerzählen zu zeigen.
3. Warum ist es wichtig, die Sicht auf Indien zu ändern?
Ein genaues Bild fördert kulturelles Verständnis, gegenseitigen Respekt und gleichberechtigte Partnerschaften in Wirtschaft und Kunst. Es ermöglicht, Indien für seine Innovation, reiche Kulturen und Menschlichkeit zu sehen, nicht nur für seine Herausforderungen.
4. Wie planen sie das umzusetzen?
Vor allem durch Film und Medien. Sie kreieren und produzieren Geschichten, die in der indischen Realität verwurzelt sind, aber universelle Themen haben, um sowohl indisches als auch internationales Publikum anzusprechen.
Vertiefende Fragen
5. Was sind konkrete Beispiele ihrer Arbeit?
- Mira Nairs "Monsoon Wedding": Zeigte eine moderne indische Oberschichtfamilie und durchbrach das Klischee von Indien als nur traditionell oder arm.
- "A Suitable Boy": Bot eine nuancierte Sicht auf das Indien nach der Unabhängigkeit, seine Politik und Sozialstrukturen.
- Ihre Produktionsfirma Ek Katha: Ist darauf spezialisiert, solche authentischen, crosskulturellen Geschichten zu finden und zu finanzieren.
6. Welche Klischees stellen sie in Frage?
Sie hinterfragen das Bild Indiens als monolithische Kultur, die Überbetonung von Armut und Slums, das magisch-spirituelle Stereotyp und die Darstellung indischer Frauen als ausschließlich unterwürfig.
7. Was ist die größte Herausforderung?
Die größte Hürde ist die Überwindung jahrzehntealter, eindimensionaler Darstellungen in westlichen Medien. Es erfordert nicht nur neue Geschichten, sondern auch deren weltweite Verbreitung und Sichtbarkeit.