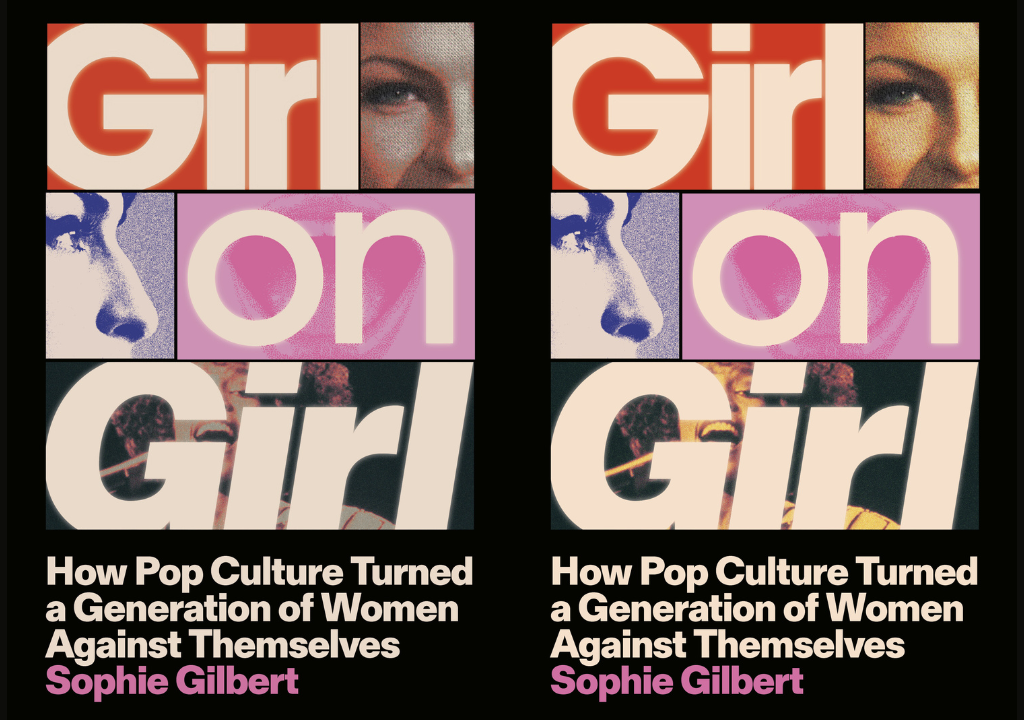Sophie Gilbert, eine Redakteurin bei The AtlanticThe White LotusSeveranceGirl on Girl: Wie die Popkultur eine Generation von Frauen gegen sich selbst aufgebracht hatVogueVogue:Sophie Gilbert:Roe v. WadeVogue:„Wir versuchen zu verstehen, warum alles schiefgelaufen ist, um uns einen kraftvolleren Weg nach vorn vorstellen zu können.“Gilbert:Vogue:Gilbert:Vogue:Gilbert:GirlhoodPen15Lady BirdChewing GumEuphoriaShallow HalKnocked UpWhite ChicksBringing Down the House„Die Frauen, die unsere Kultur angeblich am meisten hasst, sind oft die, von denen wir nicht wegsehen können.“The AtlanticDieses Gespräch wurde redigiert und gekürzt.Girl on Girl: Wie die Popkultur eine Generation von Frauen gegen sich selbst aufgebracht hat
28 $ | BOOKSHOP